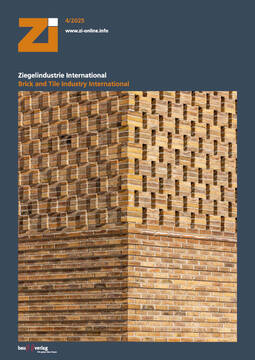Rückblick auf die 28. Tagung der Ziegeleimuseen
Am 29. und 30. Juni fand die 28. Tagung der Ziegeleimuseen im LWL-Museum Zeche Nachtigall statt. Rund 20 Teilnehmer trafen zusammen, um die Zeche kennenzulernen, sich über die Arbeit der Museen sowie Neuigkeiten auszutauschen.
Sonntag
Sonntagnachmittag trafen sich die Teilnehmer am Bahnhof der Zechenfeldbahn und fuhren mit ihr auf das Gelände der Zeche Nachtigall. Dort wurden sie von den Organisatoren Willi Kulke, Johana Simon und Laura Opel vom Ziegeleimuseum Lage des Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), sowie den Gastgebern, dem Leiter des Museums Zeche Nachtigall Gerben Bergstra und seinem Stellvertreter Nikolai Ingenerf, begrüßt. Bergstra und Ingenerf stellten die Geschichte des 1892 stillgelegten Bergwerks und des Museums vor und gingen auf die Geschichte des Kohleabbau im Ruhrgebiet ein. Das Zechengelände fand im Anschluss andere Verwendung zur Herstellung von Baumaterial. Aus Steinbrüchen wurde Sandstein gewonnen sowie Schieferton, aus dem in einer eigens errichteten Dampfziegelei bis zu elf Millionen Ziegel jährlich hergestellt wurden. Auch eine Fabrik zur Herstellung von Ziegeleimaschinen gab es.
Nach den Redebeiträgen konnten die Teilnehmer das Zechengelände erkunden und an einer Führung durch den 130 Meter langen Besucherstollen teilnehmen. Nikolai Ingenerf erläuterte dort u.a. anhand von Gebrauchsgegenständen im Stollen die Arbeitsbedingungen. Gebückt im dunklen Gang zwischen Streben und Bohlen war es nicht schwer, sich auszumalen, wie fordernd die Arbeit unter Tage war.
Zum Abschluss des ersten Tages trafen sich die Teilnehmenden zum gemeinsamen Abendessen. Dabei gab es sehr schöne Gelegenheiten zum Austausch.
Montag
Der zweite Tag war dem Vortragsprogramm gewidmet. Im ersten Vortrag ging Laura Opel auf den „Mythos Ziegel – Zwischen Emotionalität und Rationalität“ ein. Darin erörterte sie die heterogenen Eigenschaften, die über das physische Objekt hinausgehend dem Ziegel von verschiedener Seite zugeschrieben werden. Im Marketing erscheint der Ziegel bspw. als beständig, nachhaltig und natürlich. Als in bestimmten Zeitabschnitten besonders bevorzugter Baustoff hat der Ziegel besondere Bedeutung erlangt, bspw. als Baustoff der Industriekultur. Schließlich laden auch die Tradition und deren Pflege bspw. in Lippischen Zieglervereinen den Ziegel mit Bedeutungen auf. Auch die Tagung selbst setze den Mythos Ziegel fort.
Im Folgenden stellten Inga Wopke und Joris Coolen vom Fachamt für Wohndenkmalpflege LWL-Archäologie für Westfalen ein historisch-archäologisches Projekt vor unter dem Titel: Hartes Pflaster! Archäologische Prospektion der Deutschen Keramit-Werke in Dorsten-Holsterhausen.
Ausgangspunkt war eine Luftaufnahme eines Getreidefeldes in Dorsten aus dem Jahr 2010 mit Spuren früherer Bebauung. Nach anfänglichem Verdacht antiker Spuren einer römischen Besiedlung zeigte sich, dass es um Reste eines 1911 gegründeten Keramitwerkes handelte. Keramit ist ein sehr harter Klinkerstein aus Kalkton, dessen Herstellung 1903 in Budapest patentiert wurde. Verbreitet war der Straßenbaustoff vor allem auf dem Gebiet der K.u.k-Monarchie sowie in Osteuropa. Allerdings erwies er sich als ungeeignet, da er bei Nässe eine spiegelglatte Oberfläche bildet. Laut Dokumenten soll das Werk, das 1914 wieder stillgelegt wurde, über einen Ringofen mit 136 Meter Länge und 25 Meter Breite verfügt haben. 1916 wurde hier ein Elektrostahlwerk errichtet, das bis in die 20er Jahre betrieben wurde.
Coolen beschrieb die Methoden der auf dem Gelände durchgeführten geo-physikalischen Prospektion, Bodenradar und magnetische Untersuchungen. Mit letzterer lassen sich nicht nur Metalle sondern auch keramische Bauteile erkennen. Die Vorstellung der Messergebnisse führte zu einer lebhaften Diskussion um deren Deutung.
Über den Wandel des Ziegeleiparks Mildenberg vom Denkmal der Industriekultur zum außerschulischen Lernort referierte Katja Zakrzewski, Museologin des Ziegeleiparks. Inspiriert durch einen Vortrag der Museumspädagogin Jessica Waldera auf der letztjährigen Tagung der Ziegeleimuseen habe man in Mildenberg ein neues museumspädagogisches Konzept erarbeitet. Im Zentrum stand die Erkenntnis, dass Besuchergruppen, vor allem Schüler, den Ziegeleipark eher als Freizeit- und Abenteuerraum erleben. Um den musealen Aspekt stärker zu betonen, wurde ein dialogisches Workshop-Konzept für verschiedene Altersgruppen entwickelt. Der Ziegeleipark soll so als ein Ort außerschulischen Lernens wahrgenommen und genutzt werden. Den ersten Testlauf wird das Workshop-Konzept am 2. Juli erlebt haben.
Im letzten Vortrag „Rohstoffe, Regionen, Reichtum - ein unfaires Spiel?“ stellte Nikolai Ingenerf ein interaktives Sonderausstellungsprojekt vor, das besonders bei Schülergruppen beliebt ist. Dabei handelt es sich um ein Spiel, bei dem die Teilnehmer in der Rolle von Ländern um Rohstoffe, ökonomische Erfolg und den Erhalt der internationalen Ordnung spielen. Die Mechaniken des Spiels erinnern an Computerspiele wie Siedler oder Civilization. Auch die erwachsenen Teilnehmer der Tagung konnten sich bei einem Probespiel sichtlich für diesen Ansatz der Museumspädagogik begeistern.
Berichte aus den einzelnen Ziegeleimuseen in Westerholt, Cham und Lage bildeten den Abschluss des Vortragsprogramms.
Im letzten Tagungsordnungspunkt wurden die Teilnehmer gebeten, in kleinen Gruppen museologische Fragestellungen von Ziegeleimuseen zu reflektieren. Die Ergebnisse schließlich wurden gesammelt und diskutiert.
Im kommenden Jahr ist wieder eine Tagung der Ziegeleimuseen geplant.