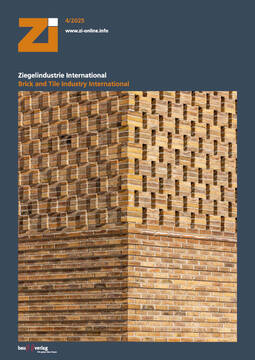Zwischen Kosten und Kohlendioxid – ein Besuch im rein elektrisch betreibbaren Hocheffizienz-Ziegelwerk von Wienerberger Österreich
Einleitung
Die weitgehende Einsparung bzw. Vermeidung von CO2-Emissionen stellt eine technische und ökonomische Herausforderung für die Ziegelindustrie dar. Wienerberger, gegründet 1819 und mit mehr als 200 Produktionsstätten in 28 Ländern der weltgrößte Ziegelhersteller sowie der europaweit größte Dachziegelhersteller, hat einen Versuch unternommen, diese zu überwinden. Im Hintermauerziegelwerk in Helpfau-Uttendorf in Österreich sind umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz vorgenommen und ein rein elektrisch betriebener Industrieofen eingebaut worden. Zi-Chefredakteur Victor Kapr und Redaktionsbeirat Doktor Fritz Mödinger haben sich durch das Werk führen und das Ganze erläutern lassen. Was alles angestellt wurde, um sich von 90 Prozent des vorher emittierten CO2 zu befreien, warum es noch nicht sicher ist, dass die Zukunft der Ziegelherstellung elektrisch sein wird, und, wieso Effizienz der Schlüssel ist, lesen Sie in der folgenden Reportage.
Das Werk Helpfau-Uttendorf
Das Werk in Helpfau-Uttendorf in der Nähe von Braunau am Inn in Oberösterreich erwarb Wienerberger 1987. Hergestellt werden dort jährlich rund 50 Millionen nicht isolierende Hintermauerziegel für Außen- und Innenwand. Der Standort wird für Technikdemonstrationen im Betrieb genutzt. Bspw. kam hier im Jahr 2019 erstmalig eine industrielle Hochtemperatur-Wärmepumpe (DryFiciency) für Trocknungsprozesse zum Einsatz. Außerdem steht hier ein eher kalkarmer Ton zur Verfügung, was die prozessbedingten Emissionen begrenzt. Aus diesen Gründen wurde das Projekt „GreenBricks“ zur Dekarbonisierung der Ziegelherstellung, gemeinsam betrieben von Wienerberger und dem AIT Austrian Institute of Technology, hier angestoßen.
Das Projekt „GreenBricks“
Das Projekt „GreenBricks“ ist Teil von NEFI – Neue Energie für die Industrie, einem Innovationsverbund mit 23 Projekten zur Entwicklung technologischer und systemischer Lösungen für die Energiewende in der Industrie, gefördert von der österreichischen Bundesregierung. Aufgrund des vorangegangenen Projekts DryFiciency bestanden bereits Technologiepartnerschaft und Kontakte zwischen Wienerberger, NEFI und AIT. Darauf wurde mit „GreenBricks“ aufgebaut.
Ziel ist, die Umweltfolgen der Ziegelherstellung, energie- und prozessbedingte CO2-Emissionen, zu verringern. Im Vergleich zum Referenzzeitraum vor dem Umbau sollen im Produktionsprozess die CO2-Emissionen um 90 Prozent gesenkt und die Energieeffizienz um 30 Prozent erhöht werden. Das Projekt begann im Oktober 2022 und kommt im September 2025 zum Abschluss. Das gesamte Projektvolumen beläuft sich auf rund 30 Millionen Euro. Fünf Millionen Euro Investitions- und 1,7 Mio. Euro Forschungskosten wurden vom österreichischen Staat gefördert.
Fünf Unterziele wurden formuliert und laut Wienerberger als Meilensteine erreicht:
„Ganzheitliche Optimierung des Ziegelherstellungsprozesses“ mittels digitaler Abbildung des Ziegelwerks (digitaler Zwilling) und Modellierung zur techno-ökonomischen Optimierung auf Werksebene
Entwicklung neuer, möglichst CO2-freier Tonmischungen mit kohlenstoffneutralen Porosierungsmitteln und Testung für verschiedene Produktionsstandorte und Produkte
Optimierung des Trockners im Verbund: Anpassung der Trocknerregelung und Inbetriebnahme erweiterter Trocknertunnel mit Wärmepumpen
Kommissionierung und Inbetriebnahme eines hocheffizienten, elektrisch betriebenen Tunnelofens
Vorbereitung Technologieübertragung auf Werksebene innerhalb der Wienerberger Gruppe in mindestens fünf Werke in drei Ländern. Prüfung, inwieweit Elektrifizierung von Chargen- und Durchlauföfen für die Herstellung anderer keramischer Produkte und in anderen Sektoren übertragbar ist.
Führung durch das Werk
Vorbemerkungen
Durch das Werk führt Projektleiter Rene Pesendorfer. Er erläutert, dass im Rahmen des Umbaus die Produktion im Sommer 2023 ausgesetzt und im Herbst 2024 wieder angefahren wurde. Auch danach fanden noch Arbeiten statt. So konnten die Wärmepumpen wegen Lieferschwierigkeiten erst im Frühjahr 2025 eingebaut werden.
Zusammengefasst wurde laut Pesendorfer Folgendes im Werk auf- bzw. umgebaut: Eine neue Porosierungsmittel-Aufbereitung, weil die neue Mischung einen deutlich höheren Anteil an Sägespänen aufweist; Anpassung der Tonaufbereitung; Verlängerung des Trockners bei gleicher Produktion unter Beibehaltung der internen Umwälzung; Installation von drei Wärmepumpen; Entwicklung und Installation eines elektrischen Schubplattenofens; Anpassung und Erweiterung der Setzanlage gemäß den Anforderungen des neuen Ofens.
Jede Einheit für sich sei, so Pesendorfer, nicht kompliziert. Die herausfordernde Aufgabe, an deren Lösung das Team derzeit arbeitet, sei, alles zu einem System zu verschalten, das eine hohe Produktqualität bei Einhaltung der energetischen Limits erlaubt.
Ein klassischer Verbund von Ofen und Trockner besteht nicht. Die dem Trockner aus der Sturzkühlung zugeführte Wärmemenge beträgt circa ein Drittel des Bedarfes. Die restliche Wärmeenergie wird über Wärmepumpen bereitgestellt.
Als Backup existiert noch ein Gasanschluss zur Versorgung von Trockner und Dampfkessel. Das erlaube erweiterte Betriebsmöglichkeiten, so Pesendorfer. Fallen die Wärmepumpen aus, besteht trotzdem genug Kapazität zur Wärmeerzeugung für 100 Prozent Leistung. Diese Reservefähigkeit sei wichtig, weil das Werk primär zur Ziegelproduktion und erst sekundär als Demonstrationsstandort dient. Außerdem stehe die vorhandene technische Gasinfrastruktur aus Leitungen und Brenner für später eventuell verfügbares Biogas oder andere CO2-neutrale gasförmige Brennstoffe zur Verfügung. Er hält es nicht für ausgeschlossen, dass das Werk im Hybrid-Betrieb laufen könnte.
Das Ziel, die CO2-Emissionen um 90 Prozent zu verringern, habe man erreicht, sagt Pesendorfer. Bei der Steigerung der Energieeffizienz um 30 Prozent sei man noch nicht ganz so weit, aber guter Dinge, es zu schaffen.
Elektrische Versorgung
Im Trafohaus sind Transformatoren mit einer Gesamtleistung von knapp 10 MW mit einer Versorgungsspannung von 110 KV installiert. Die Leistung wird zu mehr als 50 Prozent ausgenutzt, Raum für Erweiterungen ist vorhanden. Vom circa 5 km entfernten Hauptumspannwerk wurde eine neue Leitung gezogen. In der näheren Umgebung des Ziegelwerkes besteht eine sehr gut ausgebaute Netzinfrastruktur, da in der Vergangenheit einige Großverbraucher in der Gegend angesiedelt waren. Die Investition in die elektrische Infrastruktur stellt einen kleinen zweistelligen Prozentsatz der Gesamtkosten des Projektes dar. Eine neue Verteilstation vervollständigt die versorgungseitigen Elektroinstallationen.
Die Kapazität der Leitung biete mit 13 MW Potenzial für Nachrüstungen, die installierte Leistung lietgt bei rund 6 MW (3 MW für den Ofen, 1 MW für Wärmepumpen und 2 MW für Aufbereitung, Formgebung, Transport und weiteres). Die Photovoltaikanlage auf dem Dach verfügt über eine installierte Peak-Leistung von 1 MW. Den restlichen grünen Strom liefert der lokale Versorger Energie AG.
Aufbereitung
Die Tonaufbereitung wurde revisioniert und den neuen Betriebsbedingungen angepasst.
Trockner
Der vorhandene Drehlüftertrockner wurde im Hinblick auf eine Niedertemperaturtrocknung wesentlich umgebaut. Dabei wurden die Luftführungen teilweise geändert und das Volumen des Trockners selbst deutlich erhöht.
Die im umgebauten Werk eingesetzte neue Mischung aus Tonen und Porosierungsmitteln weise, so Pesendorfer, andere Trocknungseigenschaften als die alte Mischung auf und neige vermehrt zur Rissbildung. Deshalb sei auch die Führung des Trockners entsprechend geändert worden.
Zur Wärmeversorgung des Trockners zusätzlich zu der Energie aus der Ziegelkühlung sind drei Wärmepumpen mit einer elektrischen Kapazität von 330 KW installiert. Dabei handelt es sich um Kompressionswärmepumpen mit Ammoniak als Kältemittel. Die Trocknerluft wird im Kreislauf über einen Kondensator geführt. Die Leistungszahl, also das Verhältnis von abgegebener Wärmeleistung zu zugeführter elektrischer Verdichterleistung beträgt im Regelfall 3,7.
Im Werk werden derzeit in zwei Schichten Ziegel produziert, die in drei Schichten getrocknet und gebrannt werden. Vor allem in Bezug auf die Trocknung führe dies gegenüber einem klassischen Dreischichtbetrieb zu relativ höheren Energieverbräuchen durch unregelmäßige Beschickung des Trockners. Empirische Verbrauchsanalysen der Wärmepumpen lassen den Schluss zu, dass ein Betrieb in Teillast gegenüber einem Betrieb in Volllast nachteilig ist.
Ofenbeschickung
Die Beschickung und Entladung des Ofens erfolgt anstatt eines klassischen Schienensystems mit einem automatisierten System sogenannter Automatic Guided Vehicles (AGV). Alternativen zur automatischen Steuerung sind vorhanden und können bei Bedarf die Automatik ersetzen. Das System wurde von der Firma TecnoFerarri zusammengestellt und geliefert. Die AGV erlauben eine präzise Positionierung der Besatzträger mit den Ziegelpaketen auf den Unterförderketten des Ofens mit Abweichungen von weniger als drei Millimetern.
Ofenbesatz
Statt eines Ofenwagens kommen Balken aus Siliziumkarbid (SiC) von Saint-Gobain (vgl. ZI 2/25, S. 14) als Besatzträger, auf denen das Ziegelpaket aufgestapelt wird, zum Einsatz. Zwischen den einzelnen Lagen des Paketes werden beim Setzen automatisch Abstandshalter eingelegt. Diese dienen der besseren Umspülung mit Heißluft im Ofen. Die Abstandshalter werden beim Entstapeln des Paketes automatisch wieder entfernt. Die Notwendigkeit einer teilweisen Vereinzelung des Besatzes begründet Pesendorfer mit dem Risiko der Bildung von Schmolz und schwarzen Kernen. Das Verhältnis von Ziegel zu Luft in einem elektrisch betriebenen Ofen liege weit unter dem eines klassischen Tunnelofens, erklärt er.
Das Be- und Entladen erfolgt mit SCARA-Robotern (Selective Compliance Assembly Robot Arm). Die sind wegen ihrer geringen Größe gewählt worden und heben die Ziegel vom AGV auf die Balken aus SiC. Die Ausrichtung des Pakets wird mittels eines Lasers gesteuert. Zusätzlich gibt es zwei Kontrollen, weil die Spaltbreiten mit kleiner drei Zentimetern sehr gering sind.
Ofen
Aufbau
Der Ofen ist eine komplette Neukonstruktion der Onejoon GmbH (zur Entwicklung des Ofens vgl. ZI 5/2025). Der Ofenkörper besteht aus vorgefertigten Elementen mit einer Länge kleiner 2 Meter und ist mit doppelten Einfahr- und Ausfahrschleusen versehen. Auf Luftdichtigkeit wurde sehr großer Wert gelegt. Besatzträger und Ofenelemente besitzen dieselbe Länge.
Keramischer Brand
Der Besatz wird im Ofen nicht kontinuierlich geschoben, sondern, wie in einem klassischen Tunnelofen, in Intervallen bewegt. Die Möglichkeit eines kontinuierlichen Schubes wird geprüft. Technische Probleme, beispielsweise die Oberflächentemperatur der Heizelemente, könnten einem solchen Betrieb entgegenstehen.
Feuerung
Von einer Feuerung im klassischen Sinne mit einer offenen Flamme kann man beim elektrisch beheizten Tunnelofen nicht sprechen. Der Ofen wird mit in der Decke und den Seitenwänden eingelassenen Brennstäben, die mit SiC verkleidet sind, beheizt. Die eingesetzte elektrische Leistung der Brennelemente entspricht in etwa der effektiven Feuerungsleistung eines herkömmlichen Tunnelofens.
Um eine ausreichende Umwälzung der Ofenluft und somit Umspülung des Brenngutes zu erreichen, werden gezielt bestimmte Mengen Luft mit relativ hohem Druck von den Seiten und von oben in den Brennraum eingeblasen.
Die derzeitigen Zykluszeiten entsprechen den üblichen Schubzeiten für den Rohstofftyp. Für eine Steigerung der Geschwindigkeit stehen Reserven zur Verfügung.
Aus dem Ofen wird heiße Luft abgesaugt. Ein Dampfkessel dient als Wärmetauscher.
Die organischen Porosierungsmittel führen zur Bildung von Schwelgasen, die abgesaugt und in die Umwelt geleitet werden. Der Einsatz von Porosierungsmitteln mit einem weniger belastenden Emissionsspektrum wird erforscht.
Einschätzung
Nach der Führung gab es die Gelegenheit, auch mit dem Geschäftsführer der Wienerberger Österreich, Johann Marchner, zu sprechen. Die Werksumrüstung in Uttendorf sieht er als technischen Erfolg. Man könne Ziegel in industriellem Maßstab rein elektrisch unter Umgehung des größten Teils der Emissionen und hocheffizient brennen.
Das Problem der Energie- und CO2-Kosten
Auf die Frage der wirtschaftlichen Machbarkeit des Vorhabens lasse sich keine eindeutige und einfache Antwort geben. Derzeit sind fossile Energieträger noch bis zu 50 Prozent günstiger als Strom aus erneuerbaren Quellen. Dies resultiert in wesentlichen höheren Produktionskosten des weitgehend dekarbonisierten Produktes. Würden die gesamten Mehrkosten an den Markt weitergegeben, würden sich der Kostenanteil des Baustoffes Ziegel am Gesamtgewerk um einen kleinen, einstelligen Prozentsatz erhöhen. Inwiefern dies durchzusetzen wäre, bedarf noch der Prüfung.
Eine Kompensation der höheren Energiepreise durch Verrechnung mit Einnahmen im Rahmen des EU-Emissionshandelssystem können den Preisunterschied der Energieträger reduzieren. Doch auch das bedarf einer detaillierten Betrachtung.
Dazu kommen, ergänzt Pesendorfer, die nicht unerheblichen Kosten der Elektrifizierung eines Werkes, unabhängig vom Elektroofen: Neben den Investitionskosten für die Leitungsinfrastruktur über Land und die technische Infrastruktur beim Versorger fallen mit steigender Stromabnahme höhere Kosten für die Netzgebühren an. Schließlich liegen die Lieferkosten von grünem Strom noch immer über denen von konventionellem. Er resümiert: „Auf der CO2-Schiene machst du alles richtig, aber der Kaufmann wendet sich mit Grausen ab“.
Trotz der schwierigen ökonomischen Darstellbarkeit sei Wienerberger überzeugt, so Marchner, dass man mit dem Projekt auf dem richtigen Weg sei. Erstens sei es ein konkreter Schritt in Richtung auf das von der EU vorgegebene Ziel der Treibhaus-gasneutralität. Zweitens könne man so demonstrieren, dass der Ziegel mit hoher Energieeffizienz ein ökologisches und für zukünftige Bauaufgaben geeignetes Baumaterial sind.
Energieeffizienz als Schlüssel
Angesichts der noch ungewissen Zukunft über die technischen Pfade zur grünen Ziegelherstellung seien, da sind sich Geschäftsführer und Projektleiter einig, die Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Uttendorf aktuell von größerer Bedeutung für Wienerberger als die Demonstration, dass elektrischer Ziegelbrand in industriellem Maßstab möglich ist. Pesendorfer erläutert dies aus technischer Sicht: Würden im Betrieb 30 – 40 Prozent Energie eingespart und mit Erdgas gearbeitet, ließen sich bei weiterhin konkurrenzfähigen Produktpreisen 60 Prozent der CO2-Emissionen einsparen. Die dazu nötigen Umbaumaßnahmen seien im Kosten-Nutzen-Verhältnis sehr effizient und könnten mittelfristig in allen Werken von Wienerberger umgesetzt werden. Deshalb sei ein Teil des Projekts „GreenBricks“ der werkübergreifenden Übertragung von Technologie und deren Skalierung auf größere Betriebe als in Uttendorf gewidmet. Denn auch an Standorten mit anderen Rahmenbedingungen bei Rohstoffen und Stromversorgung sowie größeren Produktionsvolumina können die in Uttendorf angewandten Effizienzmaßnahmen helfen, den Energiebedarf, die CO2-Emissionen und damit die Kosten deutlich zu verringern.
Aufgrund dieser Ungewissheit sei der Trockner im Uttendorfer Werk noch gasfähig und der neue Ofen mit Modifikationen ebenso. Es sei denkbar, wenn zukünftig ein CO2-neutrales Gas zu einem wirtschaftlichen Preis und in ausreichender Menge zur Verfügung stehen sollte, weiterhin bzw. wieder mit Gas zu brennen.
Wie es weiter gehen wird
Wienerberger wird sowohl den elektrischen Brand als auch die Effizienzsteigerungsmaßnahmen weiterverfolgen. Nach dem Riemchenwerk in Kortemark, Belgien, und dem Hintermauerziegelwerk Uttendorf sollen auch die anderen beiden Produktgruppen rein elektrisch hergestellt werden. In Großbritannien soll ein Dachziegelwerk und in Kirchkimmen in Deutschland ein Vormauerziegelwerk auf elektrischen Brand umgerüstet werden.
Die in Uttendorf gewonnenen Erkenntnisse zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Setzweise, zum Luft-Ziegel-Verhältnis, zum Zusammenspiel Ofen-Trockner-Wärmepumpe u. ä. werden auf ihre Übertragbarkeit auf andere Standorte geprüft. Wenn diese Elemente „marktfähig“ sind, sollen sie auch in anderen Werken, unabhängig vom Brennstoff, umgesetzt werden.
Abschließend betont Marchner, dass man stolz sei, in Österreich mit dem Projekt grüner Hintermauerziegel begonnen zu haben. Lobend hebt er hervor, dass der Projekterfolg sich weitgehend der hohen technischen Kompetenz der Mannschaft verdanke. Die Mitarbeiter haben das gesamte Projekt begleitet, sich die erforderlichen neuen Fähigkeiten angeeignet und trotz vieler Herausforderungen und Unbekannter sehr gut zusammengearbeitet.